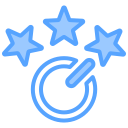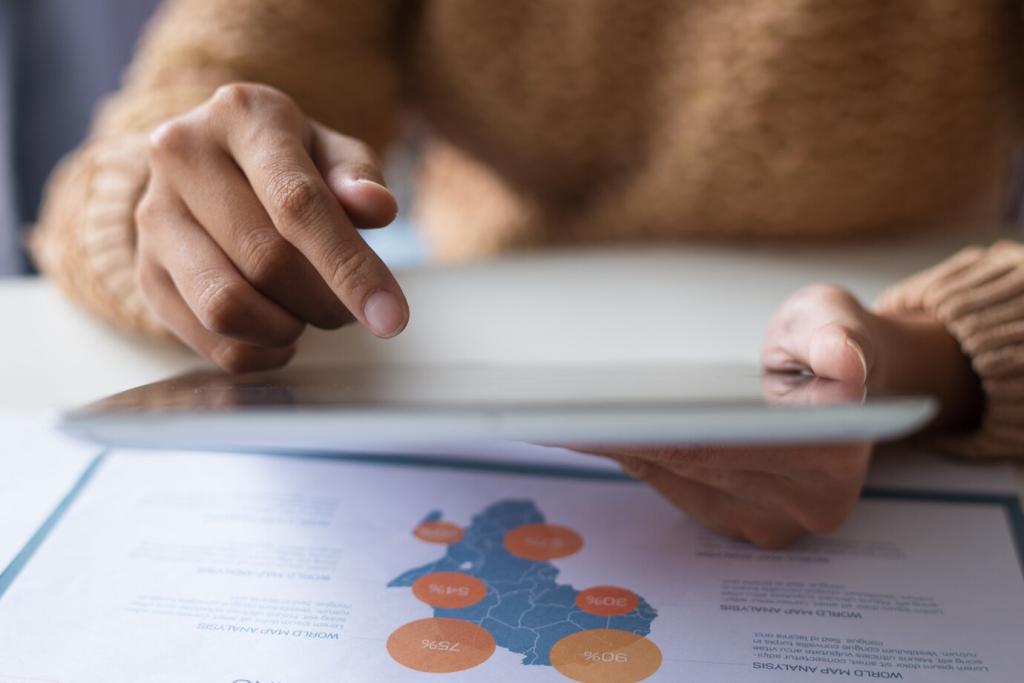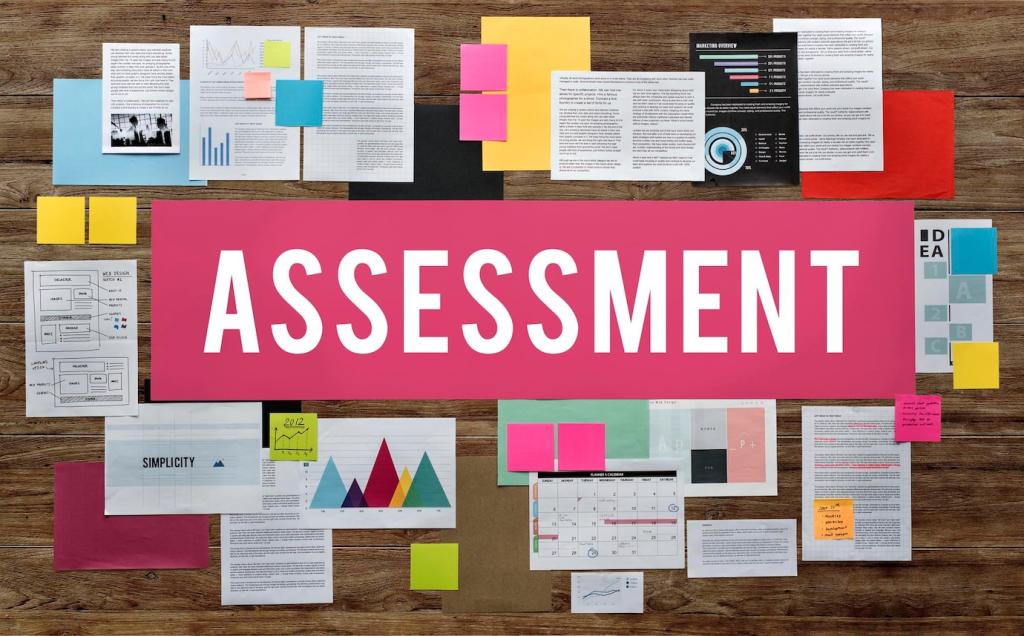Fallgeschichte: Eine Nachbarschaftsküche gegen Hypertonie
In einem Stadtteil mit geringer Nahversorgung und hoher Stressbelastung starteten Ehrenamtliche, eine Apothekerin und ein Gesundheitscoach eine Nachbarschaftsküche. Ziel war bessere Ernährung, weniger Salz, mehr Bewegung und messbare Verbesserungen des Blutdrucks, getragen von Vertrauen und Gemeinschaft.
Fallgeschichte: Eine Nachbarschaftsküche gegen Hypertonie
Wöchentliche Kochkurse, Rezeptkarten in einfacher Sprache, kostenfreie Blutdruckchecks, SMS-Erinnerungen und Peer-Gruppen sorgten für Struktur. Ein klarer Evaluationsplan definierte Kennzahlen, Erhebungszeitpunkte und Verantwortlichkeiten. Schreib uns, welche Bausteine in deinen Projekten den größten Unterschied gemacht haben.
Fallgeschichte: Eine Nachbarschaftsküche gegen Hypertonie
Nach sechs Monaten sank der mittlere systolische Blutdruck um sieben Millimeter Quecksilbersäule, die Salzaufnahme reduzierte sich spürbar, und die Selbstwirksamkeit stieg. Statistische Signifikanz traf auf praktische Relevanz. Stimmen aus der Gruppe beschrieben besseres Schlafen, weniger Kopfschmerzen und neue Routinen.
Fallgeschichte: Eine Nachbarschaftsküche gegen Hypertonie
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.